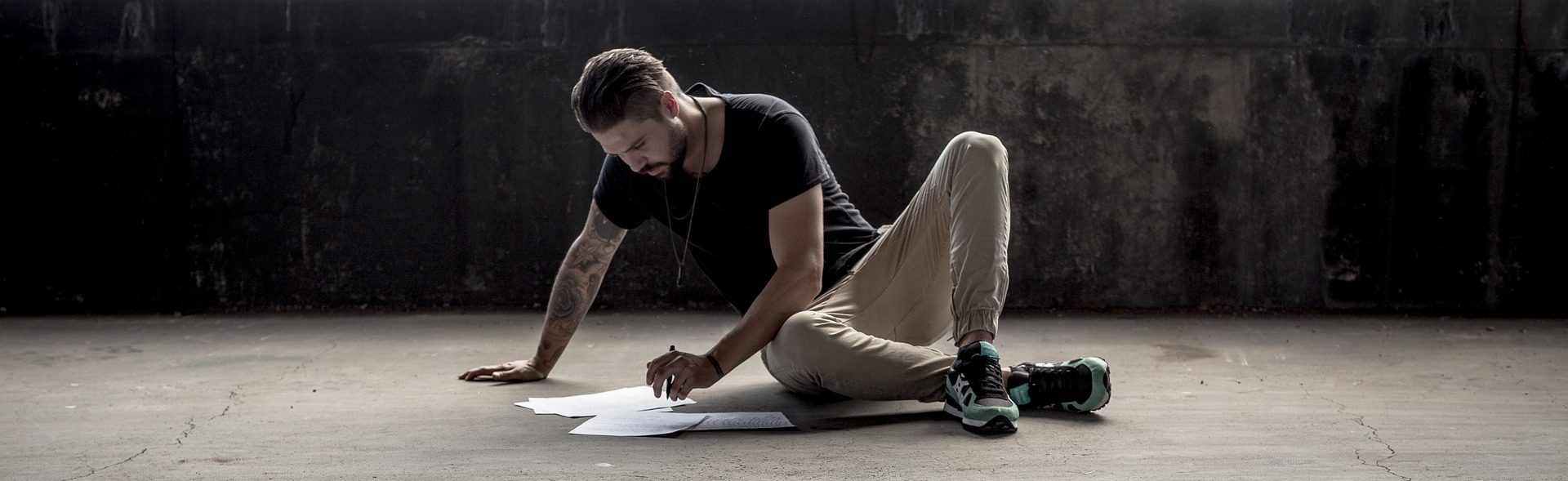Messen, zählen, beweisen – so sieht echte Wissenschaft aus. Oder?
Aber was, wenn genau dieses Bild in manchen Bereichen zu kurz greift und du dadurch wichtige wissenschaftliche Perspektiven verpasst?
In diesem Beitrag schauen wir uns an, was es mit dem Positivismus wirklich auf sich hat: Warum er lange Zeit das Bild von Wissenschaft geprägt hat, wo seine Stärken liegen – aber auch, warum er nicht das Maß aller Dinge ist.
Bleib also unbedingt dran, denn wenn du die Grundbausteine der Wissenschaftstheorie verstehst, hast du nicht nur im Studium einen Vorteil – sondern auch überall sonst, wo gute Argumente zählen.
Inhaltsverzeichnis
Was ist Positivismus?
Positivismus ist eine wissenschaftstheoretische Haltung. Sie geht davon aus, dass echtes, zuverlässiges Wissen nur auf objektiven, beobachtbaren und messbaren Fakten basieren kann. Alles Subjektive – wie Meinungen, Gefühle oder Überzeugungen – wird ausgeklammert, weil es sich nicht eindeutig überprüfen lässt.
Der Begriff geht zurück auf Auguste Comte, der im 19. Jahrhundert auch soziale Phänomene mit der gleichen Systematik untersuchen wollte, wie es bisher die Naturwissenschaften getan hatten. Wissenschaft sollte für ihn auf klaren Regeln, messbaren Daten und neutraler Beobachtung beruhen.
Auch heute noch ist der Positivismus in vielen Bereichen stark verankert – neben den Naturwissenschaften zum Beispiel die Medizin, die Psychologie oder auch die Betriebswirtschaftslehre. Wobei letztere stark positivistisch geprägt angefangen haben und mittlerweile immer pluralistischer werden. Und sogar in den Naturwissenschaften wird die reine Objektivität als Ideal oftmals kritisch reflektiert.
Was gilt eigentlich als wissenschaftlich?
Der Positivismus hat unser Verständnis von Wissenschaft stark geprägt: Objektivität, Messbarkeit, Nachvollziehbarkeit, Wiederholbarkeit – diese vier Schlagworte gelten bei vielen bis heute als Inbegriff von Wissenschaftlichkeit.
Aber ist das wirklich alles? Diese Sichtweise hat lange dazu geführt, dass andere Formen von Wissen als „unwissenschaftlich“ abgestempelt wurden – zum Beispiel Erfahrungswissen, kulturelle Deutungen oder emotionale Perspektiven.
Gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften wuchs im 20. Jahrhundert der Widerstand gegen diese Engführung. Immer häufiger wurde gefragt: Ist Messbarkeit wirklich das oberste Kriterium? Oder brauchen wir ein breiteres Verständnis davon, wie Wissen entsteht?
Heute gilt immer mehr: Es gibt nicht die eine Methode, um Erkenntnisse zu gewinnen. Auch subjektive Erfahrungen, historische Narrative oder kulturelle Kontexte können wissenschaftlich wertvoll sein – solange sie systematisch und nachvollziehbar erschlossen werden.
Diese Frage ist übrigens alles andere als theoretisch. Sie betrifft deinen Studienalltag: Welche Methoden du nutzt, welche Texte du zitierst, wie du argumentierst – all das hängt mit deinem eigenen Wissenschaftsverständnis zusammen. Hast du das schon mal hinterfragt?
Wenn du beispielsweise ein kontrolliertes Experiment designst oder Interviews führst, entscheidest du dich bewusst oder unbewusst für einen wissenschaftstheoretischen Standpunkt.

Positivismus in quantitativer Forschung
In der quantitativen Forschung sind positivistische Grundannahmen bis auf wenige Ausnahmen der Standard. Hier geht es darum, Hypothesen zu testen, Theorien mit Zahlen (also statistische Methoden) zu überprüfen und aus objektiven Daten allgemeingültige Aussagen abzuleiten.
Ein Beispiel: Du willst herausfinden, ob Studierende, die häufiger in der Bibliothek lernen, bessere Noten schreiben. Also erhebst du messbare Daten – wie Bibliotheksbesuche und Notendurchschnitte – und analysierst statistisch, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Was hier nicht vorkommt: persönliche Eindrücke, individuelle Motive oder Emotionen. Subjektive Einflüsse werden oft als potenzielle Störvariablen betrachtet, die kontrolliert werden sollten.
Und genau das ist auch die Schwäche: Der Positivismus funktioniert super bei klar messbaren Phänomenen. Aber wie misst du Motivation, Angst oder Vertrauen? Wie quantifizierst du Liebe oder Trauer?
Genau an dieser Stelle setzt die Kritik am Positivismus an.
Qualitative Forschung: Ein Gegenentwurf zum Positivismus?
Und hier kommt die qualitative Forschung ins Spiel. Sie funktioniert nach anderen Regeln und fängt da an, wo der Positivismus aufhört.
In qualitativen Studien geht es nicht um Zahlen, sondern um Bedeutungen. Um Erfahrungen, Perspektiven, Emotionen. Statt zu messen, will man verstehen.
In Interviews, Beobachtungen oder Gruppendiskussionen werden Phänomene aus Sicht der Beteiligten interpretiert. Die Welt wird nicht als messbar, sondern als vielschichtig, subjektiv und kontextabhängig betrachtet.
Viele qualitative Ansätze basieren deshalb auf einem interpretativen oder konstruktivistischen Weltbild – nicht auf positivistischem Denken. Es gibt jedoch auch qualitative Ansätze, die nicht streng anti-positivistisch sind (z. B. bestimmte Varianten der qualitativen Inhaltsanalyse, die so systematisch und regelgeleitet vorgehen, dass sie gewisse Prinzipien des Positivismus übernehmen. Die Intercoder-Reliabilität wäre ein Beispiel dafür. Hier misst du anhand einer Zahl, wie zuverlässig ein Team an Forschenden qualitative Daten ausgewertet hat.
Und genau das führt in der Forschungspraxis häufig zu echten Konflikten. Ich selbst arbeite oft qualitativ, weil ich darin mehr Raum für die Komplexität und Subjektivität der Themen sehe, die ich gerne erforschen möchte. Aber in vielen Fachbereichen oder bei bestimmten Reviewern wird die quantitative, positivistische Herangehensweise immer noch als „richtiger“ oder „härter“ angesehen. Das kann bei Forschungsprojekten, Drittmittelanträgen oder auch bei Abschlussarbeiten zu echten Auseinandersetzungen führen.

Ist der Positivismus noch zeitgemäß?
Auch wenn viele positivistische Prinzipien noch immer verwendet werden, stellt sich heute zunehmend die Frage: Reicht dieses Wissenschaftsverständnis noch aus?
Gerade in den Sozialwissenschaften wird der Anspruch auf objektive, neutrale Beobachtung immer wieder kritisiert. Denn: Forschende sind keine Roboter. Sie bringen ihre Biografie, ihren kulturellen Hintergrund und ihre Perspektiven immer mit ein, ob sie wollen oder nicht.
Erkenntnistheoretische Ansätze wie der Feminismus oder die Standpunkttheorie sagen: Objektivität bedeutet nicht, subjektive Einflüsse zu ignorieren – sondern sie transparent zu machen.
Besonders in den Gender Studies oder in der postkolonialen Theorie wird Positivismus deshalb oft kritisch betrachtet. Er kann dazu führen, dass dominante Perspektiven als „neutral“ verkauft werden – während andere Stimmen unsichtbar bleiben.
Dann nimm jetzt Teil an meinem neuen online CRASH-KURS! (100% kostenlos)
(und erfahre die 8 Geheimnisse einer 1,0 Abschlussarbeit)
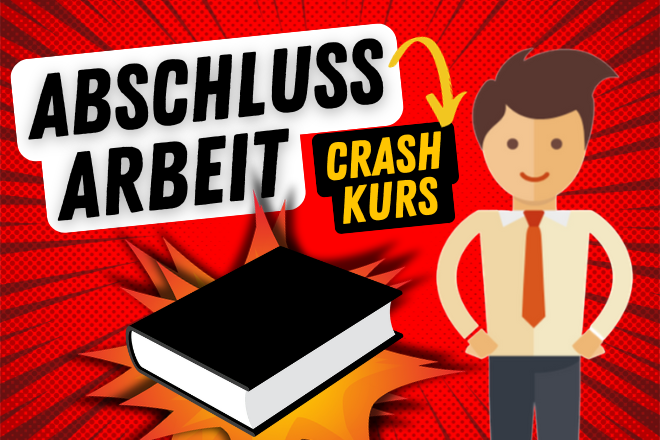
Mixed Methods: Zwischen Messen und Verstehen
Wenn dir reine Zahlen zu wenig, reine Interviews aber zu subjektiv erscheinen, brauchst du vielleicht beides. Und genau das bieten Mixed Methods.
Hier werden quantitative und qualitative Methoden kombiniert – zum Beispiel: Erst eine Umfrage, dann Interviews, um die Ergebnisse zu vertiefen.
Aus klassisch-positivistischer Sicht ist das ungewohnt. Aber moderne Forschungsdesigns nutzen bewusst beide Paradigmen: die Messbarkeit der Zahlen und die Tiefe der subjektiven Perspektiven.
Gerade bei komplexen Fragestellungen, bei denen es sowohl um Muster als auch um Bedeutungen geht, ist dieser Ansatz extrem hilfreich. Wichtig ist nur: Du brauchst eine gute Begründung, warum du beide Methoden nutzt – und eine Strategie, wie sie sich optimal ergänzen können.
Was heißt das für deine Forschung?
Wenn du gerade an einer empirischen wissenschaftlichen Arbeit sitzt, stell dir drei Fragen:
- Willst du messbare Zusammenhänge aufzeigen? → Quantitativ, positivistisch.
- Willst du subjektive Sichtweisen verstehen? → Qualitativ, interpretativ.
- Willst du beides? → Mixed Methods.
Je besser du dein Erkenntnisinteresse kennst, desto klarer wird, welche Methode und welche theoretische Haltung zu deinem Projekt und zu dir als forschende Person passt.
Und: Desto überzeugender wird auch deine Argumentation.
Deine Meinung ist gefragt
Was denkst du? Sollte die Wissenschaft dem Positivismus treu bleiben oder ist mehr Pluralismus gefragt?
Schreib’s in die Kommentare – ich bin gespannt!
Wenn du auf dem Weg zu mehr Erfolg im Studium noch ein wenig Starthilfe für deine wissenschaftliche Arbeit benötigst, dann habe noch ein PDF für dich, das du dir gratis herunterladen kannst:
Die 30 besten Formulierungen für eine aufsehenerregende Einleitung