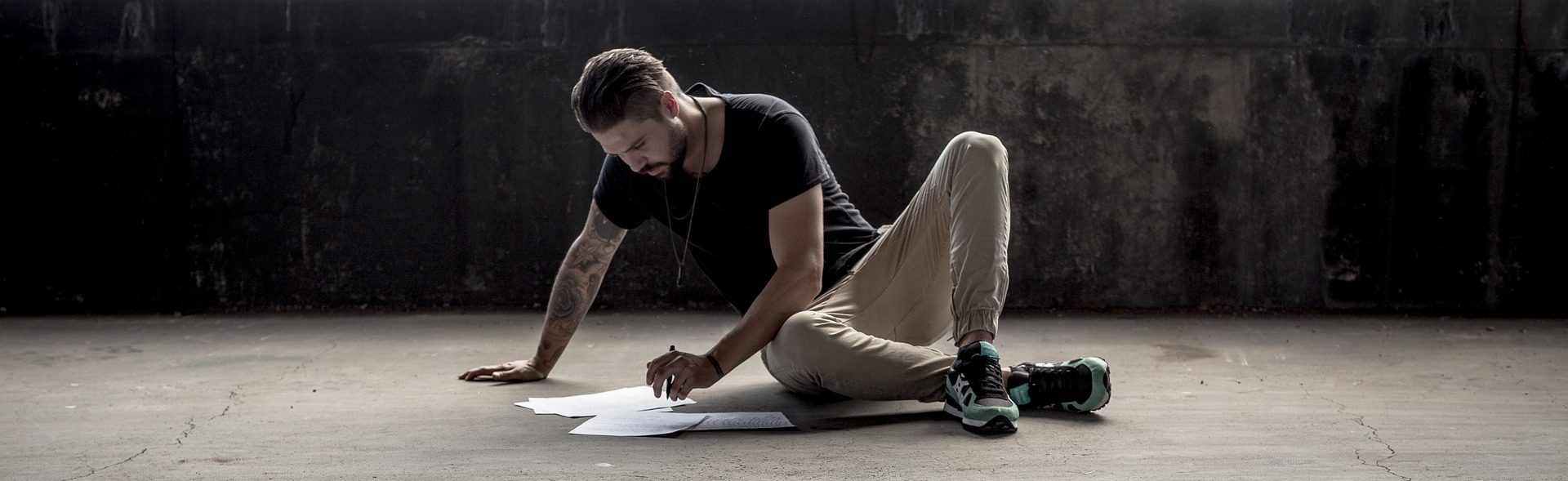Jede Woche bekomme ich wissenschaftliche Arbeiten auf den Tisch: als Betreuer, Gutachter und Reviewer. Und weißt du was? Es sind immer wieder die gleichen Fehler, die mir sofort ins Auge springen.
Das Krasse: Diese Fehler finden sich nicht nur in Bachelorarbeiten, sondern sogar in Dissertationen und Paper-Einreichungen. Und genau diese Kleinigkeiten können darüber entscheiden, ob deine Arbeit als solide Forschung durchgeht (oder gnadenlos zerrissen wird).
Darum zeige ich dir jetzt die 7 häufigsten Fehler, die ich ständig sehe. So kannst DU sie vermeiden und bietest Gutachtern so wenig Angriffsfläche wie möglich.
Inhaltsverzeichnis
#1 Unvollständige Quellenangaben
Wenn du mit einer Literaturmanagementsoftware arbeitest, ist das schon mal sehr lobenswert. Danke, dass du meine Gebete erhört hast! Den Fehler, den viele machen, ist anzunehmen, dass die Meta-Daten, die du von Google Scholar & Co. importierst, automatisch vollständig sind.
Lädst du zum Beispiel eine Studie von ScienceDirect herunter, hast du in deiner Datei, die du in Zotero, Citavi oder Endnot einfügst, so eine komische Artikel-ID, die anstatt der korrekten Seitenzahl in den Meta-Daten gespeichert ist. Wenn du jetzt in Word einfach die Zitation einfügst, ohne die Meta-Daten anzupassen, bekommst du diese Literaturangabe:
Wazulin, L., Jamin, M., Andone, I., Blaszkiewicz, K., Reinhard, I., Eibes, M., … & Bach, P. (2025). Investigation of smartphone use characteristics underlying problematic smartphone use by dense longitudinal smartphone tracking. Computers in Human Behavior, 108766.
Das ist selbstverständlich falsch – egal in welchem Zitierstil.
Nehmen wir an, du zitierst nach APA, dann muss die Quellenangabe so aussehen:
Wazulin, L., Jamin, M., Andone, I., Blaszkiewicz, K., Reinhard, I., Eibes, M., … & Bach, P. (2025). Investigation of smartphone use characteristics underlying problematic smartphone use by dense longitudinal smartphone tracking. Computers in Human Behavior, 173, 1-13.
Du musst also manuell das Volume (die 173) und die Seitenzahlen (1-13) eintragen, indem du im PDF nachschaust. Dieses Journal hat keine Issues, also kannst du auch keines in Klammern nach dem Volume angeben, aber das ist in Ordnung.
Diese Änderungen machst du aber natürlich in deiner Literaturmanagementsoftware und nicht in deinem Literaturverzeichnis. So stellst du sicher, dass alle Informationen vollständig sind, wenn du die Quelle noch mal zitierst.
#2 Inkonsistente Groß- und Kleinschreibung
Das hier gilt besonders für Kapitel-Überschriften, Überschriften in Tabellen-Zellen und in den Beschriftungen von Abbildungen. Mal groß, mal klein, hier wird oft alles durcheinandergewürfelt.
Ein geübtes Auge, und das besitzen alle deine Gutachter, sieht das sofort. Und weil Wissenschaftler über die Jahre so eine Art Zwangsneurose in dieser Hinsicht entwickelt, treffen sie diese lapidar erscheinenden Formatierungsfehler mitten ins Mark.
Es sind die Details, die deinen Gutachter gegen dich aufbringen. Besonders für studentische Arbeiten sind diese Fehler besonders ärgerlich. Das liegt daran, dass in solchen Arbeiten überprüft wird, ob du sauber wissenschaftlich arbeiten kannst.
Du musst keine bahnbrechende neue Theorie aufstellen, sondern nur zeigen, dass du das Handwerk beherrschst. Deshalb fallen solche Kleinigkeiten stärker ins Gewicht.
Die Maßnahme ist simpel: Lege dich fest, wie du mit Groß- und Kleinschreibung umgehst und halte dich daran. Und wenn du keine Formatvorlage bekommen hast, in der diese Dinge geregelt sind, dann schau dir die APA Richtlinien an. Darin gibt es Empfehlungen für alles. Psychologen sind nämlich die größten Zwangsneurotiker, wenn es ums wissenschaftliche Arbeiten geht. Und das meine ich als Kompliment. Ich bin ja schließlich auch einer.

#3 Inkonsistente Begrifflichkeiten
Wissenschaftliches Arbeiten ist eine Kunst, aber vielmehr noch ein Handwerk. Viele Studierende gewichten das künstlerische Element fälschlicherweise höher als das handwerkliche.
Dadurch entstehen dann Texte, in denen es keine Wiederholungen gibt. Für den gleichen Begriff werden fleißig Synonyme gesucht – und gefunden. Social Media werden dann abwechselnd als Soziale Netzwerke, Digitale Plattformen und Soziale Medien bezeichnet.
Für Gutachter ein gefundenes Fressen.
Was ist der Unterschied zwischen diesen Begrifflichkeiten? Ist AirBnB nicht auch eine Digitale Plattform? Wie ist dieser Begriff definiert? Inwiefern unterscheidet er sich von dem Begriff soziale Medien? Warum wird er in diesem Kontext verwendet?
Wissenschaftliche Arbeiten müssen nicht schön klingen. Sie müssen präzise sein.
Lege dich auf einen Begriff fest und benutze ihn konsistent in deiner ganzen Arbeit. Auch, wenn dadurch sprachliche Wiederholungen entstehen. ChatGPT und andere Tools helfen dir hier nicht – es sein denn du promptest so, dass das Sprachmodell genau darauf achtet.
#4 Komplizierter schreiben, um „wissenschaftlicher“ zu wirken
Viele Studierende glauben, dass wissenschaftliches Schreiben bedeutet, ihre Sätze möglichst lang und kompliziert zu formulieren. Doch die Wahrheit ist: Gute wissenschaftliche Texte sind vor allem klar und verständlich.
Kurze Sätze, eine klare Struktur, keine unnötigen Füllwörter – das ist der Schlüssel. Ein hilfreicher Trick: Verfasse deinen ersten Entwurf so, als würdest du das Thema einem Freund erklären. Erst danach ersetzt du die einfachen Begriffe durch Fachbegriffe und ergänzt die passenden Zitationen. Auf diese Weise bleibt dein Text lesbar, ohne im Fachjargon zu ersticken.
Merke dir: Komplexität beeindruckt Prüfer nicht – Klarheit schon. Wer verständlich schreibt, zeigt, dass er sein Thema wirklich durchdrungen hat.
Dann nimm jetzt Teil an meinem neuen online CRASH-KURS! (100% kostenlos)
(und erfahre die 8 Geheimnisse einer 1,0 Abschlussarbeit)
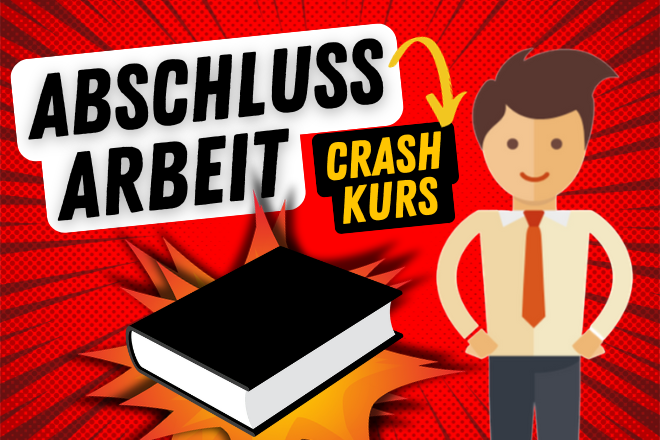
#5 Zentrale Begriffe nicht definieren
Ein Klassiker in vielen wissenschaftlichen Arbeiten, die ich sehe: Wichtige Begriffe werden einfach vorausgesetzt, ohne sie sauber zu definieren.
Das Problem dabei ist, dass jeder Leser – ob Gutachter, Betreuer oder Kommilitone – andere Vorstellungen mit denselben Begriffen verbinden kann. Wenn du also nicht klar festlegst, was du unter einem Begriff wie Motivation, Innovation oder Nachhaltigkeit verstehst, entsteht sofort Interpretationsspielraum.
Und das ist Gift für eine präzise Argumentation.
Die Lösung: Definiere deine zentralen Begriffe gleich zu Beginn und beziehe dich dabei auf hochwertige wissenschaftliche Quellen. Hochwertig heißt aus den absoluten Top-Fachzeitschriften deiner Disziplin.
So stellst du sicher, dass alle Leser mit denselben Arbeitsdefinitionen weiterdenken – und du vermeidest Missverständnisse, die dir später einen saftigen Punktabzug einbringen können.
#6 Autoren-zentriert schreiben
Viele Studierende verfassen ihre Literaturübersicht autorenzentriert. Das heißt, sie reihen einfach aneinander, wer was gesagt hat: „Müller (2020) meint …, Schmidt (2021) schreibt …, Meier (2022) widerspricht …“. Das Ergebnis ist meist eine endlose Liste von Namen, Jahreszahlen, und Studienergebnissen – aber keine eigenständige Analyse der Literatur.
Deutlich hilfreicher ist eine konzeptzentrierte Darstellung. Dabei strukturierst du nicht nach Autoren, sondern nach Themen oder Konzepten. Beispiel: „Die Forschung zu Motivation lässt sich in zwei Ansätze einteilen: intrinsische Faktoren (vgl. Müller 2020; Schmidt 2021) und extrinsische Faktoren (vgl. Meier 2022).“ Auf diese Weise zeigst du, wie verschiedene Studien zusammenhängen, wo es Gemeinsamkeiten und wo es Widersprüche gibt.
Kurz gesagt: Autorenzentriert = Zusammenfassen. Konzeptzentriert = Analysieren. Und genau Letzteres wollen Gutachter sehen.
Ausnahmen sind Literaturwissenschaften oder Philosophie, wo es um die Gedanken konkreter Individuen geht. Hier ist eine Autoren-zentrierte Schreibweise in vielen Fällen hilfreich.
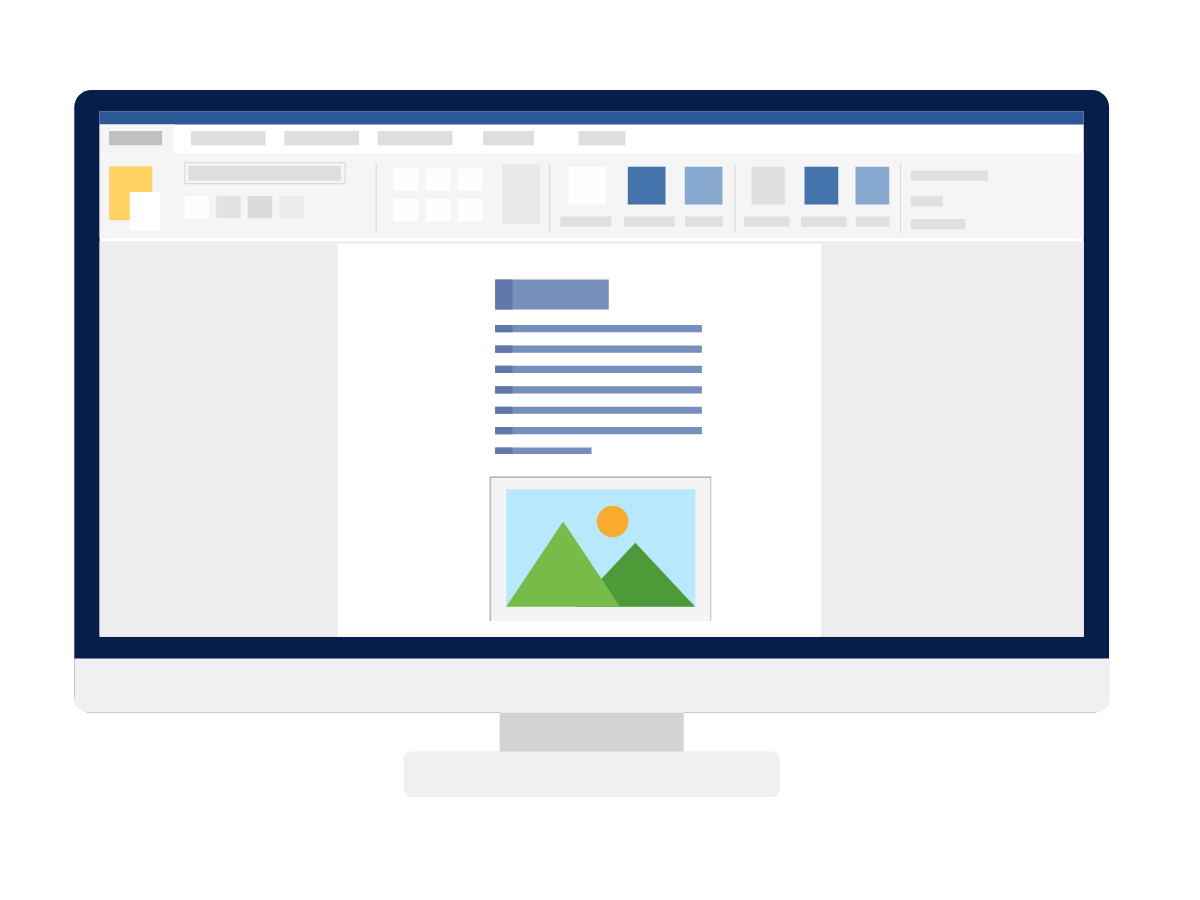
#7 Whitespace in Abbildungen
Viele Studierende gestalten ihre Abbildungen so, dass sie nicht optimal ins Layout einer Word-Seite passen. Häufig sind sie zu schmal und hochkant, sodass rechts und links viel Weißraum bleibt.
Das sieht nicht nur unprofessionell aus, sondern verschwendet auch wertvollen Platz – gerade wenn deine Arbeit ein festes Seitenlimit hat.
Die Lösung: Gestalte Abbildungen so, dass sie den verfügbaren Platz effizient nutzen. Statt langer, schmaler Grafiken solltest du öfter auf horizontale Formate setzen, die sich besser in eine A4-Seite im Hochformat einfügen.
Passe außerdem die Skalierung und Ränder an, damit deine Abbildung die Breite der Seite sinnvoll ausfüllt und deine Inhalte klar im Fokus stehen. Merke dir: In wissenschaftlichen Arbeiten zählt jeder Zentimeter. Abbildungen sollten so gestaltet sein, dass sie Platz sparen – nicht verschwenden.
Wenn du auf dem Weg zu mehr Erfolg im Studium noch ein wenig Starthilfe für deine wissenschaftliche Arbeit benötigst, dann habe noch ein PDF für dich, das du dir gratis herunterladen kannst:
Die 30 besten Formulierungen für eine aufsehenerregende Einleitung