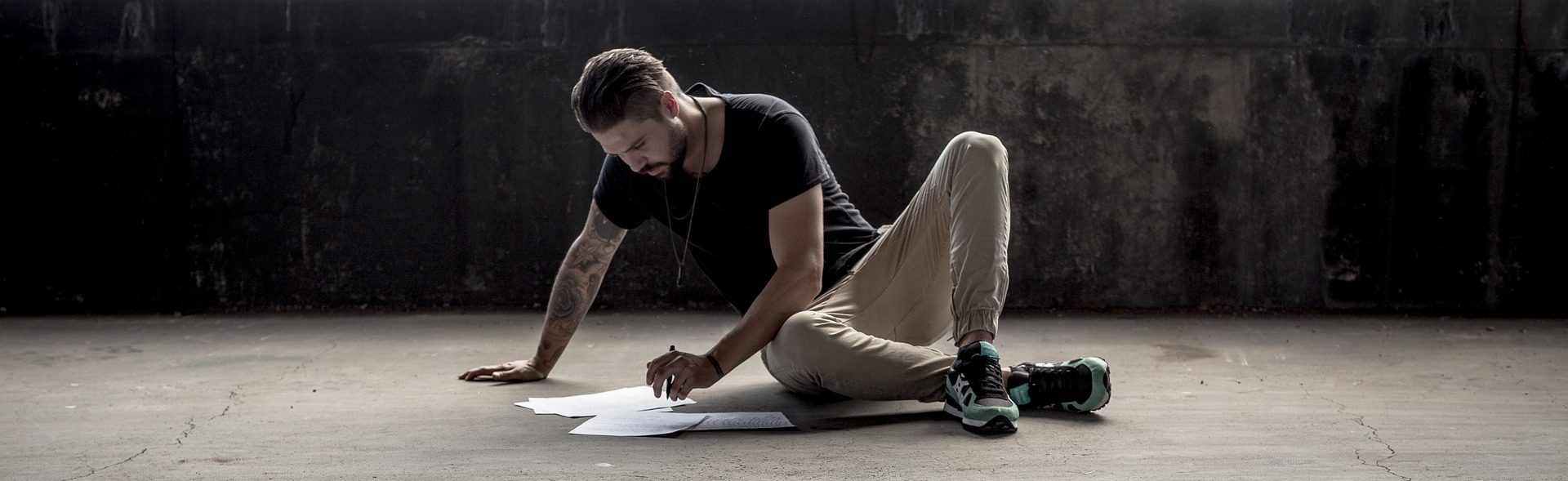Hast du schon mal erlebt, dass zwei Leute nach derselben Vorlesung komplett unterschiedlich davon erzählen? Die eine sagt: „Total spannend und praxisnah!“, der andere: „Langweilig, hab gar nichts verstanden.“ Und das, obwohl sie im selben Raum saßen. Wie kann das sein?
Willkommen im Interpretivismus – einer wissenschaftlichen Sichtweise, die genau solche Unterschiede ernst nimmt. Und nicht nur das: Sie verändert auch, wie wir forschen.
Inhaltsverzeichnis
1. Was ist Interpretivismus?
Interpretivismus ist eine erkenntnistheoretische Perspektive, die vor allem in den Sozial-, Kultur- und Bildungswissenschaften verbreitet ist.
Im Mittelpunkt steht die Annahme, dass die Welt nicht unabhängig von unserer Wahrnehmung existiert – sondern dass wir ihr durch Sprache, Erfahrungen und kulturelle Prägungen Bedeutung verleihen.
Übertragen auf die Forschung heißt das:
Wissenschaft ist nicht nur Messen, Zählen und Berechnen. Sie ist auch ein Prozess des Verstehens – des Interpretierens von Bedeutungen, Sichtweisen und Handlungsgründen.
Wer interpretivistisch forscht, fragt also nicht nur: Was passiert?
Sondern vor allem: Was bedeutet das für die Beteiligten? Was macht diese Erfahrung mit ihnen? Welche Werte, Überzeugungen oder sozialen Zusammenhänge spielen eine Rolle?
Diese Perspektive unterscheidet sich stark vom Positivismus, der davon ausgeht, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die man mit den richtigen Methoden messen kann. Im Interpretivismus hingegen gibt es nicht die eine Wahrheit – sondern viele Wahrheiten, je nach Perspektive.
2. Interpretivismus und qualitative Forschung – wie hängt das zusammen?
Wenn du dich mit Methoden des Interpretivismus beschäftigst, wirst du sehr schnell bei der qualitative Forschung landen.
Denn der Interpretivismus ist nicht nur eine theoretische Haltung, sondern er prägt auch ganz konkret, wie du deine Forschung gestaltest. Und zwar fast immer mit qualitativen Methoden.
Qualitative Forschung bedeutet:
Du arbeitest mit kleinen Stichproben und statt Zahlen zu analysieren, wertest du Sprache, Erzählungen oder Handlungen aus. Dein Ziel ist nicht, eine statistische Regel zu finden, sondern die Sinnzusammenhänge hinter dem Erlebten zu verstehen.

2.1 Qualitative Forschung
Qualitative Forschung stellt ganz andere Fragen und nutzt andere Methoden.
Hier geht es darum, wie Menschen ihre Erfahrungen deuten, welche Bedeutung sie bestimmten Situationen geben und wie sie ihre Wirklichkeit erleben.
Typische Methoden sind:
- offene Interviews
- teilnehmende Beobachtung
- Gruppendiskussionen
- Analyse von Tagebucheinträgen oder Social-Media-Posts
Das Ziel ist Verstehen statt Erklären – du möchtest ein Thema aus der Sicht der Beteiligten erfassen und zeigen, wie sie sich in ihrem sozialen Kontext orientieren.
Beispiel:
Wie erleben Studierende die Zeit vor einer wichtigen Prüfung?
Du lässt sie erzählen, stellst Nachfragen, hörst aktiv zu – und analysierst dann, was ihre Erzählungen über ihre Ängste, Routinen oder Bewältigungsstrategien verraten.
2.2 Quantitative Forschung
Quantitative Forschung basiert im Gegensatz zu den meisten qualitativen Ansätzen auf einem positivistischen Weltbild:
Es geht darum, möglichst objektive Daten zu erheben, die verallgemeinerbar sind. Häufig werden standardisierte Fragebögen, Tests oder Experimente genutzt.
Ziel ist es, Muster zu finden, Hypothesen zu testen oder Zusammenhänge nachzuweisen, etwa zwischen zwei Variablen.
Beispiel:
Wie stark hängt Prüfungsangst mit dem Notendurchschnitt zusammen?
Die Daten werden numerisch ausgewertet – etwa mit Statistikprogrammen – und sollen idealerweise Rückschlüsse auf eine große Gruppe von Menschen zulassen.
2.3 Beispiel: Prüfungsangst
Stell dir vor, du willst in deiner Forschung das Thema Prüfungsangst untersuchen.
Wie du vorgehst, hängt stark davon ab, ob du dich dem Thema aus einer positivistisch oder interpretivistisch motivierten Perspektive näherst.
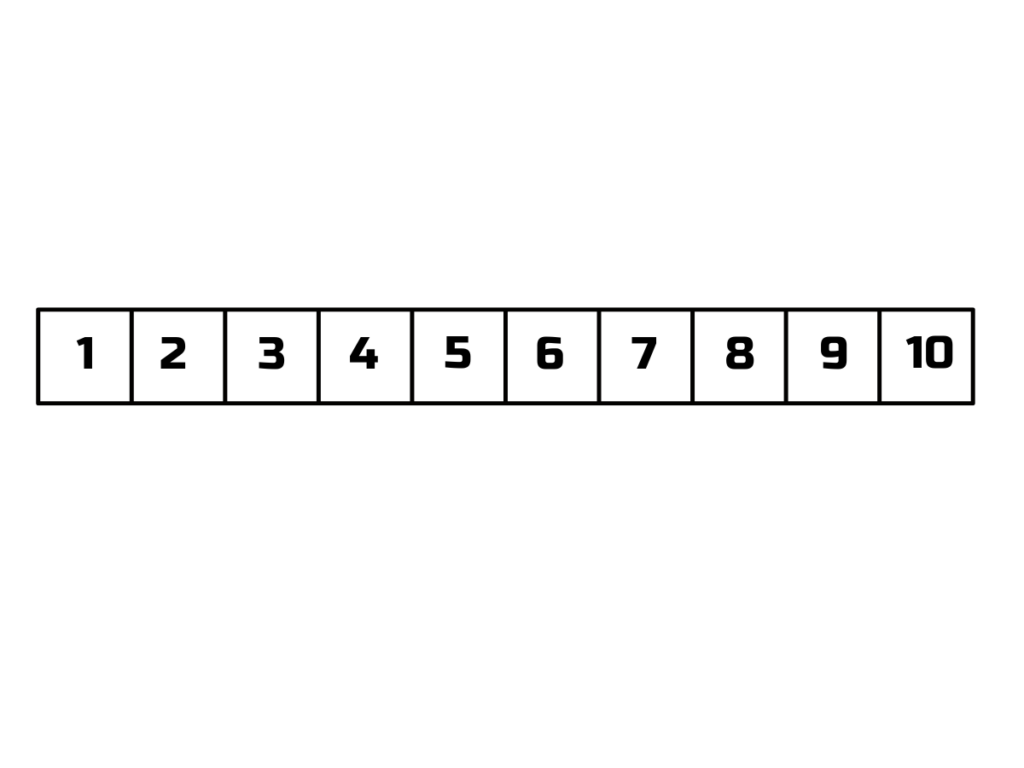
Quantitativ (positivistisch):
Du entwickelst einen standardisierten Fragebogen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten. Vielleicht lässt du die Teilnehmenden ihre Angst auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten.
Am Ende wertest du die Daten statistisch aus und untersuchst zum Beispiel, ob es einen Zusammenhang zwischen Prüfungsangst und Studienfach, Geschlecht oder Notenschnitt gibt.
Qualitativ (interpretivistisch):
Du führst offene Interviews mit einzelnen Studierenden. Du willst wissen: Wie erleben sie die Zeit vor einer Prüfung wirklich?
Was passiert in der Nacht davor? Welche Gedanken und Gefühle kommen auf? Welche Erfahrungen aus der Vergangenheit spielen eine Rolle?
Vielleicht erzählt dir eine Person, dass sie schon beim Gedanken an die Klausur Herzrasen bekommt. Eine andere sagt, dass sie zwar nervös ist, aber diese Nervosität als „positiven Druck“ empfindet.
Diese Erzählungen ergeben kein einheitliches Bild und genau das ist der Punkt: Es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern viele subjektive Perspektiven. Und interpretivistische Forschung macht diese Vielfalt sichtbar.
Wichtig:
Du musst dich nicht immer strikt für einen Weg entscheiden.
Auch Mixed-Methods-Designs sind möglich – also die Verbindung von quantitativen und qualitativen Methoden. Hier habe ich dir auch ein Video dazu verlinkt. Entscheidend ist immer: Was willst du herausfinden? Und welche Methode passt zu deiner Forschungsfrage? Positivismus und Interpretivismus sind keine Religionen, denen du treu bleiben musst, sondern Perspektiven, die du einnehmen kannst.
Dann nimm jetzt Teil an meinem neuen online CRASH-KURS! (100% kostenlos)
(und erfahre die 8 Geheimnisse einer 1,0 Abschlussarbeit)
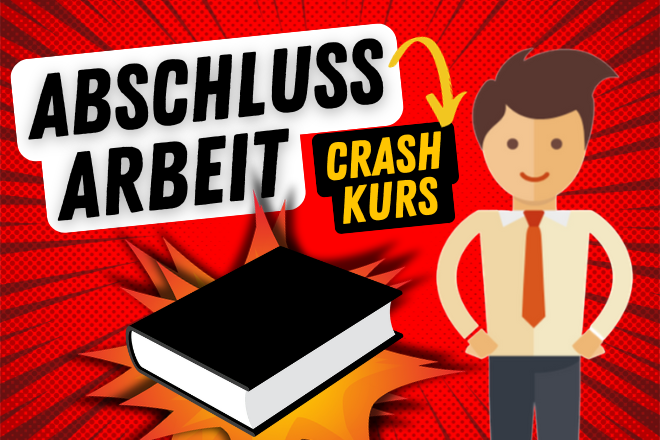
3. Ist das nicht das Gleiche wie Konstruktivismus?
Interpretivismus ist nicht dasselbe wie Konstruktivismus, aber er funktioniert nur, wenn man davon ausgeht, dass Wirklichkeit nicht objektiv feststeht, sondern sozial konstruiert ist, so wie es der Konstruktivismus beschreibt. Wenn du mehr zum Konstruktivismus wissen willst, hab ich dir hier ein Video verlinkt.
Trotzdem gibt es wichtige Unterschiede.
Während der Interpretivismus vor allem fragt, wie einzelne Personen ihre Welt erleben und deuten, interessiert sich der Konstruktivismus stärker für die Frage, wie solche Bedeutungen überhaupt entstehen, also welche sozialen, sprachlichen oder kulturellen Strukturen unser Denken prägen.
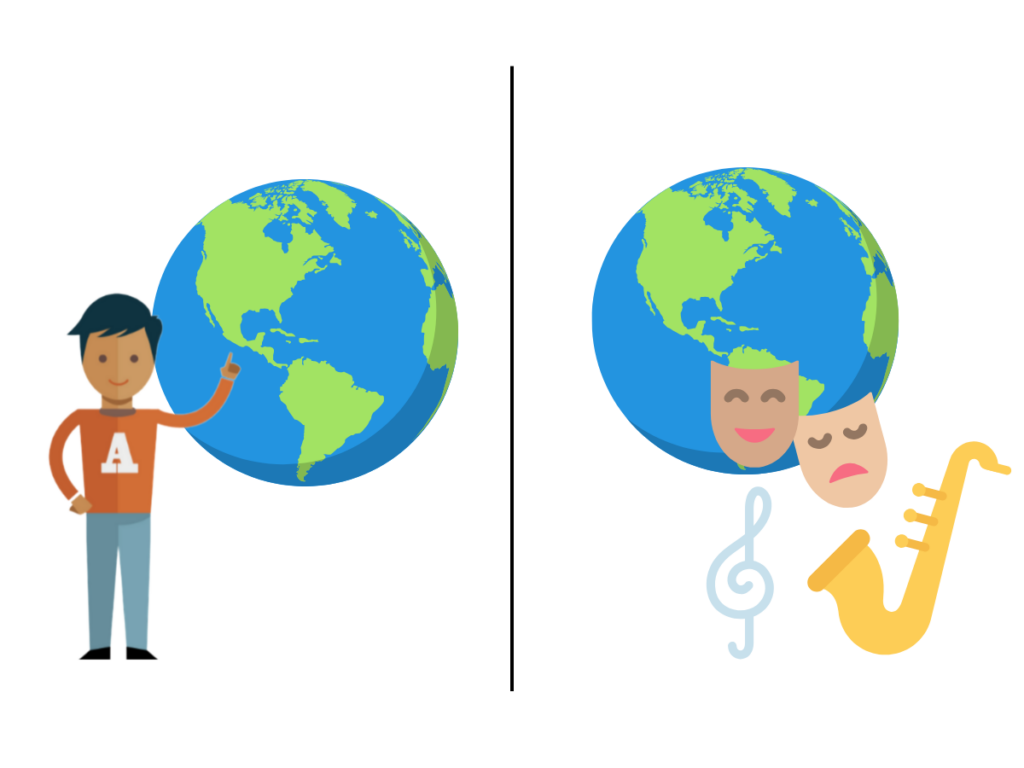
Beispiel
| Interpretivismus | Konstruktivismus |
|---|---|
| Fragt: Was bedeutet etwas für einzelne Menschen? | Fragt: Wie entstehen gesellschaftlich geteilte Bedeutungen? |
| Fokus auf individuelles Erleben | Fokus auf soziale, sprachliche und kulturelle Rahmenbedingungen |
| Beispiel: Wie erleben Studierende den Einsatz von KI in ihrer Hausarbeit? | Beispiel: Welche Diskurse, Normen oder Machtverhältnisse prägen, wie über KI im Studium gesprochen wird? |
Kurz gesagt:
Der Interpretivismus interessiert sich für das individuelle Erleben – für persönliche Bedeutungen, Gefühle, Sichtweisen. Der Konstruktivismus fragt zusätzlich, wie solche Sichtweisen zustande kommen – durch Sprache, Medien, Institutionen oder Machtverhältnisse.
Beides lässt sich gut verbinden: Du kannst zum Beispiel zunächst untersuchen, wie einzelne Studierende KI im Studium erleben (interpretivistisch) und dann analysieren, welche gesellschaftlichen Vorstellungen oder Diskurse dieses Erleben beeinflussen (konstruktivistisch).
4. Typische Herausforderungen und wie du sie löst
Wenn du interpretivistisch forschst, wirst du mit bestimmten Vorurteilen oder Unsicherheiten konfrontiert. Hier ein paar davon – und wie du ihnen begegnen kannst:
„Das ist doch alles subjektiv“
Ja – Interpretivismus arbeitet bewusst mit subjektiven Perspektiven. Genau darum geht es: Du willst zeigen, wie Menschen bestimmte Situationen erleben und interpretieren.
Wichtig ist nur, dass du dein Vorgehen transparent machst: Welche Daten hast du erhoben? Wie bist du zur Interpretation gekommen? Hast du deine eigene Perspektive reflektiert?
„Ich habe nur wenige Interviewpartner“
In der qualitativen Forschung geht es nicht um Repräsentativität, sondern um Tiefe.
Fünf sorgfältig geführte Interviews, die inhaltlich ausgewertet und reflektiert werden, können mehr Erkenntnisse bringen als 100 oberflächliche Umfragen.
„Aber das lässt sich doch nicht verallgemeinern“
Stimmt, interpretivistische Forschung will kein allgemeingültiges Gesetz formulieren.
Sie will kontextspezifisches Wissen bereitstellen, das anderen hilft, ähnliche Situationen besser zu verstehen.
Je präziser du deinen Kontext beschreibst, desto hilfreicher sind deine Ergebnisse für andere Forschende oder Praktiker.
Fazit
Wenn du das nächste Mal überlegst, wie du deine Forschungsfrage angehst, frag dich:
Geht es mir darum, was passiert – oder wie es erlebt wird?
Will ich mich mit Zahlen auseinandersetzen oder Geschichten, Erfahrungen, Deutungen?
Wenn du verstehen willst, was hinter dem Erleben von Menschen steckt, dann bietet dir der Interpretivismus die passende Grundlage, inhaltlich wie methodisch.
Wenn du auf dem Weg zu mehr Erfolg im Studium noch ein wenig Starthilfe für deine wissenschaftliche Arbeit benötigst, dann habe noch ein PDF für dich, das du dir gratis herunterladen kannst:
Die 30 besten Formulierungen für eine aufsehenerregende Einleitung