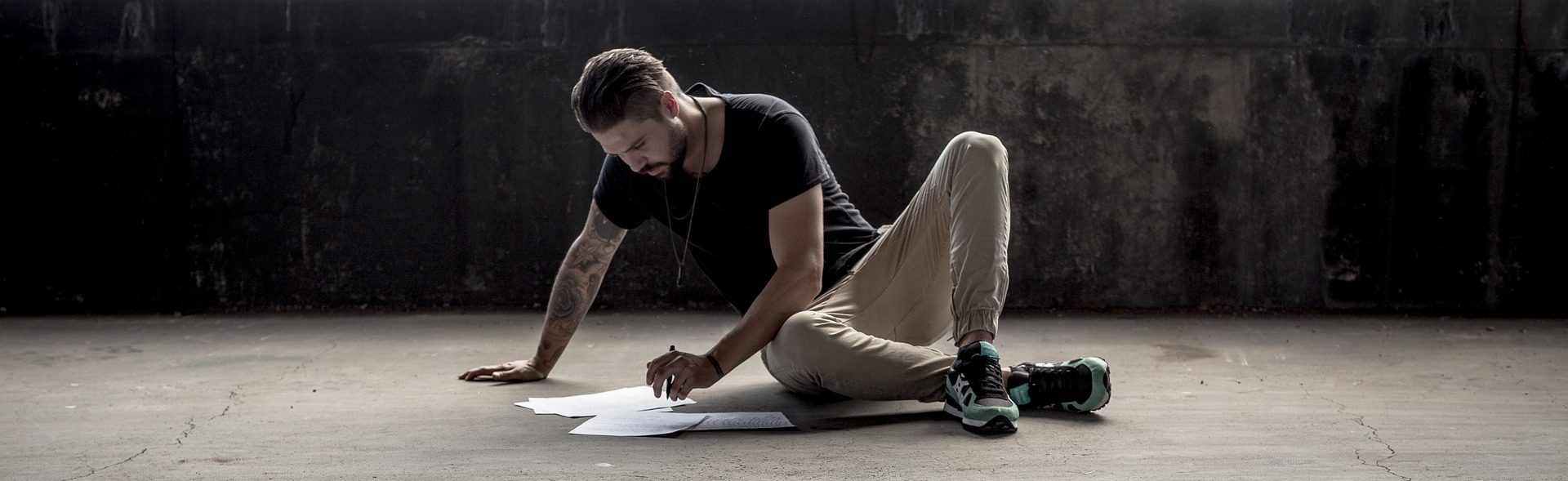Klarheit, Eindeutigkeit, Objektivität – so stellen wir uns oft Wissen vor.
Aber was, wenn Wissen erst in deinem Kopf entsteht? Was, wenn es gar keine „objektive Wahrheit“ gibt, sondern nur verschiedene Sichtweisen, die wir uns selbst konstruieren?
Genau hier setzt der Konstruktivismus an. Was ist Wissen eigentlich? Wie entsteht es? Und können wir die Welt wirklich so erkennen, wie sie ist?
In diesem Beitrag schauen wir uns an, was hinter dem Konstruktivismus steckt, warum er besonders für die qualitative Forschung wichtig ist und wie er deine Sichtweise auf deine wissenschaftliche Arbeit verändern kann.
Inhaltsverzeichnis
Was ist Konstruktivismus?
Der Konstruktivismus geht davon aus, dass Wissen nicht einfach „entdeckt“ wird, sondern konstruiert wird. Das bedeutet: Wir nehmen die Welt nicht objektiv wahr, sondern deuten sie immer durch unsere eigenen Erfahrungen, Vorstellungen und sozialen Kontexte.
Oder ganz platt gesagt: Du siehst die Welt nicht, wie sie ist – sondern wie du bist.
Was wir also als „Wirklichkeit“ bezeichnen, ist immer eine subjektive, interpretierte Version davon. Erkenntnis entsteht nicht durch neutrales Messen und Beobachten, sondern durch aktive Verarbeitung und Deutung. Und das gilt nicht nur für Einzelpersonen, sondern auch für ganze Gesellschaften. Auch kulturelle Normen, Rollenbilder oder wissenschaftliche Paradigmen sind soziale Konstrukte.
Wer hat sich das ausgedacht?
Konstruktivismus ist keine Theorie, die von einer Person entwickelt wurde, sondern eher ein Sammelbegriff für verschiedene philosophische Denkrichtungen. Erste Ideen tauchten in der Psychologie auf – etwa bei Jean Piaget, der zeigte, wie Kinder durch aktives Handeln ihre Vorstellung von der Welt aufbauen.
Später kamen Soziologen wie Berger und Luckmann dazu, die in den 1960er-Jahren erklärten, wie gesellschaftliche Wirklichkeit durch Kommunikation entsteht. Und in den 1980ern wurde der sogenannte radikale Konstruktivismus durch Ernst von Glasersfeld bekannt. Er meinte: Es gibt GAR keine objektive Realität, die unabhängig vom Beobachter existiert – nur individuelle Konstruktionen, die sich als nützlich oder nicht nützlich erweisen.
Das klingt erstmal ziemlich abstrakt, aber in der Praxis hat das enorme Auswirkungen – zum Beispiel auf die Art und Weise, wie wir forschen.
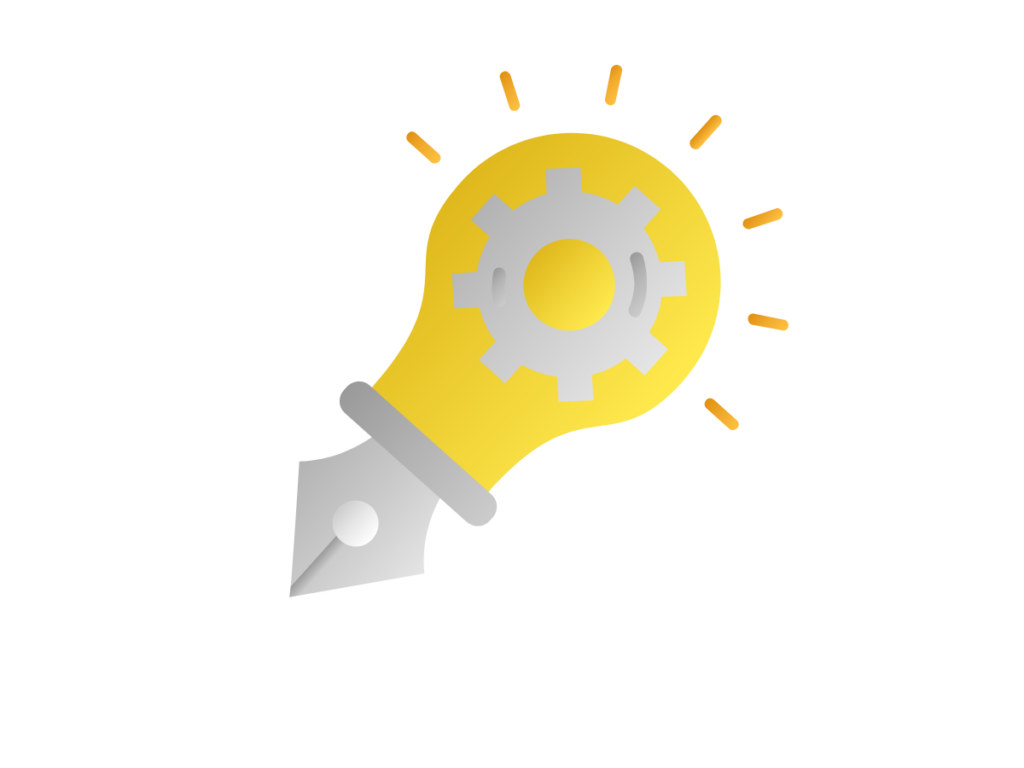
Was bedeutet der Konstruktivismus für die wissenschaftliche Forschung?
Im Gegensatz zum Positivismus, der objektive, messbare Fakten in den Mittelpunkt stellt, sagt der Konstruktivismus: Wissenschaft ist nie neutral. Forscherinnen und Forscher sind immer Teil des Forschungsprozesses – mit ihren Fragen, Vorannahmen und Interpretationen.
Besonders in der qualitativen Forschung ist das wichtig. Hier wird nicht versucht, Phänomene eindeutig zu messen, sondern sie zu verstehen. Es geht um Bedeutungen, Erfahrungen und Zusammenhänge – nicht um Zahlen und Korrelationen.
Wenn du zum Beispiel Interviews führst, möchtest du nicht einfach objektive Fakten sammeln, sondern nachvollziehen, wie deine Gesprächspartner ihre Wirklichkeit erleben. Du hörst zu, stellst offene Fragen, interpretierst Aussagen im Kontext – und kommst so zu Erkenntnissen, die zwar nicht allgemeingültig, aber dafür tief und differenziert sind.
Ist das dann nicht total subjektiv?
Doch! Und genau das ist gewollt. Der Konstruktivismus sagt nicht, dass subjektive Erkenntnisse schlecht sind, sondern dass sie die Regel sind. Objektivität im klassischen Sinne gibt es nicht. Stattdessen kommt es darauf an, transparent zu machen, wie man zu Erkenntnissen kommt – also welche Perspektive eingenommen wurde, welche Fragen gestellt wurden und wie die Daten ausgewertet wurden.
Konstruktivistische Forschung ist also nicht willkürlich, sondern nachvollziehbar und reflektiert. Es geht nicht darum, „die Wahrheit“ zu finden, sondern nachvollziehbar zu rekonstruieren, wie bestimmte Wahrheiten in einem bestimmten Kontext entstehen.
Was heißt das für dich?
Gerade im Studium kommt der Konstruktivismus oft indirekt vor – etwa wenn du qualitative Methoden lernst oder mit Theorien arbeitest, die auf Bedeutungsanalysen und Interpretationen basieren. Vielleicht hast du schon mal von den Methoden Grounded Theory, Narrative Analyse oder Diskursanalyse gehört? Viele dieser Ansätze basieren auf konstruktivistischen Annahmen.
Wenn du zum Beispiel Interviews führst, Beobachtungen machst oder Gruppendiskussionen auswertest, bewegst du dich meist automatisch im konstruktivistischen Feld – auch wenn dir das gar nicht so bewusst ist.
Deshalb ist es wichtig, dass du diese erkenntnistheoretische Grundlage verstehst. Denn sie beeinflusst, wie du deine Forschungsfrage formulierst, welche Methoden du wählst und wie du deine Ergebnisse interpretierst.
Dann nimm jetzt Teil an meinem neuen online CRASH-KURS! (100% kostenlos)
(und erfahre die 8 Geheimnisse einer 1,0 Abschlussarbeit)
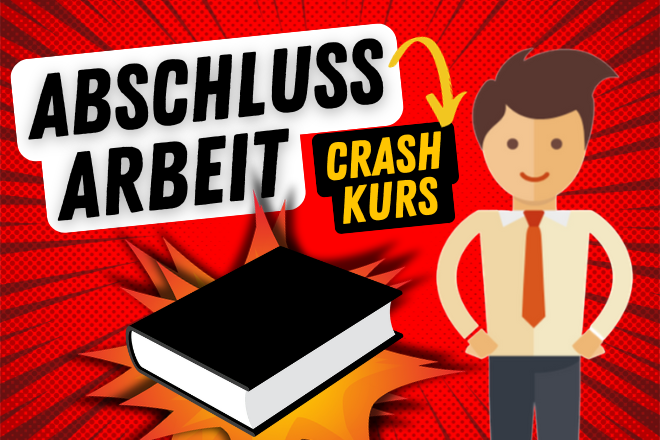
Was ist der Unterschied zum Positivismus?
Im Positivismus geht man davon aus, dass es eine objektive Realität gibt, die man durch Messung und Beobachtung erkennen kann. Die Forschenden halten sich möglichst neutral und versuchen, ihre eigenen Einflüsse aus dem Forschungsprozess herauszuhalten.
Im Konstruktivismus ist das Gegenteil der Fall: Erkenntnis ist immer subjektiv, abhängig vom Kontext – und Forschende sind nie außen vor, sondern immer Teil der Forschung.
Das bedeutet aber nicht, dass eine Haltung besser ist als die andere. Beide haben ihre Berechtigung – je nachdem, was du untersuchen willst.
Willst du wissen, wie viele Studierende ihr Studium abbrechen? → Dann bist du mit quantitativer, positivistischer Forschung gut bedient.
Willst du wissen, warum Studierende ihr Studium abbrechen – und wie sie diesen Prozess erleben? → Dann ist ein konstruktivistischer Zugang über qualitative Interviews wahrscheinlich besser geeignet.

Warum der Konstruktivismus oft missverstanden wird
„Wenn eh alles subjektiv ist, kann man sich die Forschung doch gleich sparen“ – solche Sätze fallen oft, wenn es um den Konstruktivismus geht. Der Vorwurf: Alles sei relativ, beliebig, unklar.
Doch das ist ein Missverständnis. Denn gerade konstruktivistische Forschung verlangt ein hohes Maß an Genauigkeit – nur eben auf eine andere Weise. Es geht nicht darum, neutrale Fakten zu sammeln, sondern darum, eigene Annahmen offenzulegen, Kontexte zu reflektieren und systematisch zu interpretieren, wie Bedeutungen entstehen.
Das ist keine einfache Aufgabe. Es ist ein anspruchsvoller Zugang zu Wissen – aber einer, der dort besonders stark ist, wo klassische Messbarkeit an ihre Grenzen stößt: bei Erfahrungen, sozialen Prozessen und komplexen Wirklichkeiten.
Wenn du qualitative Forschung machst oder einfach besser verstehen willst, wie Wissen entsteht, ist der Konstruktivismus eine wertvolle Perspektive, um wissenschaftliche Prozesse bewusster zu gestalten.
Wenn du auf dem Weg zu mehr Erfolg im Studium noch ein wenig Starthilfe für deine wissenschaftliche Arbeit benötigst, dann habe noch ein PDF für dich, das du dir gratis herunterladen kannst:
Die 30 besten Formulierungen für eine aufsehenerregende Einleitung